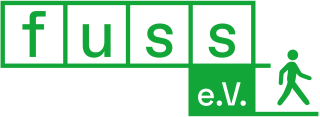Baustellen
Wie ist die Zuständigkeit für die ordnungsgemäße Absicherung einer Baustelle geregelt?

„Jede – auch kleine – Arbeitsstelle im öffentlichen Verkehrsraum bedarf vor ihrer Einrichtung einer Verkehrsrechtlichen Anordnung.“ Dabei sind insbesondere die „Verkehrssicherheitsmaßnahmen bei Arbeitsstellen von kürzerer Dauer […] besonders kritisch und sensibel“ zu begutachten.[1][2]
- Arbeitsstellen zur Straßen-Unterhaltung
- Sonstige Arbeitsstellen
- Verkehrszeichenplan
- Überprüfung
- Überwachung
- Bürger-Meldung unsachgemäßer Baustellen-Absicherung
Arbeitsstellen zur Straßen-Unterhaltung
Hierbei handelt es sich um alle Arbeitsstellen, die Maßnahmen zur Unterhaltung von Straßen darstellen oder der Verhütung von außerordentlichen Schäden im öffentlichen Straßenraum dienen. In diesem Fall ordnet die Straßenbaubehörde „vorbehaltlich anderer Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörden […] Verkehrsverbote und -beschränkungen an [… Sie kann] den Verkehr umleiten und ihn durch Markierungen und Leiteinrichtungen lenken.“[3] Nach der Auftragsvergabe an eine Firma, wird von dieser ein Verkehrszeichenplan eingeholt und geprüft. Die Polizei ist anzuhören.[4] Bei kurzzeitigen Eingriffen in den Straßenverkehr von weniger als einen Kalendertag Dauer wird die Straßenverkehrsbehörde lediglich mindestens zwei Wochen vor der Durchführung verständigt. Bei Beschränkungen und Verboten von mehr als 3 Monaten Laufzeit muss letztlich die Straßenverkehrsbehörde entscheiden. Diese kann, nach Anhörung der Straßenbaubehörde und der Polizei die angeordneten Maßnahmen aufheben oder ändern.[5]
Sonstige Arbeitsstellen
Hierbei handelt es sich um die Absicherung öffentlicher oder auch privater Baustellen, die sich auf die Abwicklung des Straßenverkehrs auswirken. In diesem Fall ist stets die Straßenverkehrsbehörde berechtigt, die entsprechenden Maßnahmen anzuordnen [6], muss allerdings auch hier die Polizei vor einer Entscheidung anhören.[7]
Verkehrszeichenplan
Für alle Arbeitsstellen, die mindestens „über eine begrenzte Stundenzahl, in der Regel bei Tageshelligkeit eines Kalendertages [hinaus] bestehen“[8] (längere Dauer) und die sich wesentlich auf den Straßenverkehr auswirken, ist die Erstellung eines Verkehrszeichenplanes verbindlich vorgeschrieben.[9] Dieser kann von der anordnenden Behörde selbst oder dem beauftragten Bauunternehmen erstellt und mit dem Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung eingereicht werden.[10] Der Plan kann am PC mit diversen EDV-Programmen oder per Hand erstellt werden, wichtig ist jedoch in allen Fällen, dass die Richtlinien einzuhalten sind. Mitunter werden auch weitere Regelwerke [11] oder Praxisratgeber [12] herausgezogen.

Der Verkehrszeichenplan beinhaltet die Auswahl der vorgesehenen Verkehrszeichen und Markierungen sowie deren Positionierung. Es muss zu erkennen sein, wie die „Arbeitsstellen abzusperren und zu kennzeichnen sind, ob und wie der Verkehr, auch bei teilweiser Straßensperrung, zu beschränken, zu leiten und zu regeln ist, ferner ob und wie sie gesperrte Straßen und Umleitungen zu kennzeichnen haben. Sie haben diese Anordnungen zu befolgen und Lichtzeichenanlagen zu bedienen“.[13]
Für Standardsituationen gibt es in den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) bereits vorgegebene Regelpläne. Diese können eins zu eins übernommen werden, wenn sich der Plan problemlos in der Realität umsetzen lässt oder sind entsprechend zu verändern. Andernfalls müssen gesonderte Verkehrszeichenpläne erstellt werden.
Vor Ort darf von der Anordnung nicht abgewichen werden. Jede Änderung muss von der Polizei eingetragen, unterzeichnet und an die zuständige Behörde weitergeleitet werden. Für den Fall, dass seitens der Behörde auf die Vorlage eines Verkehrszeichenplanes verzichtet wird, „entbindet [dies] die Behörde nicht von den erforderlichen Anordnungen“, der Überprüfung, der Überwachung und auch der Übernahme der Verantwortung.[14]
Überprüfung
Vor der Inbetriebnahme einer Baustelle muss die regelgerechte Umsetzung der Maßnahme durch die anordnende Behörde überprüft werden. Dazu gehört das Prüfen aller „Lichtzeichenanlagen", Umleitungen von Vorfahrtstraßen und Arbeitsstellen mit einer Änderung der Vorfahrt. Arbeitsstellen auf Autobahnen, Kraftfahrtstraßen und Vorfahrtstraßen sind nach der Inbetriebnahme zu prüfen. [15] Bei Geltung der ZTV-SA muss die Arbeitsstelle von der ausführenden Firma zwei Mal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich und nach Unwettern sofort überprüft werden.
Überwachung
Nach der Straßenverkehrs-Ordnung sind entweder die Straßenverkehrs- oder die Straßenbaubehörde als anordnende Behörde sowie auch die Polizei dazu verpflichtet, die planmäßige Kennzeichnung der Verkehrsregelung zu überwachen.[16] „Das gilt auch für die Zeit nach Arbeitsschluss, für die Nacht und für Sonn- und Feiertage.“[17]
Diese Überwachung „findet infolge Personalmangels auf beiden Seiten in immer geringerem Umfange statt. Hinzu kommt, dass sich die Polizei vielerorts aus den Anhörungs- und Beteiligungsverfahren zurückgezogen hat und oftmals nur noch bei Arbeitsstellen von erheblichem Umfang beteiligt werden will.“ Darüber hinaus werden „insbesondere bei Städten und Gemeinden […] häufig die Aufgaben in Bezug auf die Anordnung und Überwachung von Arbeitsstellen im Straßenraum organisatorisch in den Ordnungsämtern oder Straßenverkehrsämtern zusammengefasst. Dadurch wird die vom Gesetzgeber durch die StVO „mit gutem Grund vorgesehene Trennung der Zuständigkeiten“ (Straßenbau- und Straßenverkehrsbehörde) unterlaufen. Zustimmungs-, Genehmigungsvorbehalte und die letztliche Kontrolle der Anordnungen der Straßenverkehrsbehörden liegen dann in einer Hand.[18]
„Nachlässigkeiten bei der Erteilung von Genehmigungen und Anordnungen, sowie deren Missachtung, vermeintliche Unzuständigkeiten, mangelnde Kenntnisse um die gefahrlose Sicherung, Bequemlichkeiten, Gedankenlosigkeit, Kostengründe, Zeitmangel und Mängel in Aus- und Fortbildung (die Aufzählung ließe sich fortsetzen) bei den Behörden und den Unternehmen, aber auch bei der Polizei, sind für unsichere Arbeitsstellen und häufig für die daraus resultierenden Verkehrsunfälle verantwortlich.“[19]
Bürger-Meldung unsachgemäßer Baustellen-Absicherung
Bürger sollten sich in jedem Fall auch beim Verdacht der oder beim Wissen (vgl. Vorgaben und Kriterien) über die Nichteinhaltung der Regelungen der Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) an die Straßenverkehrsbehörde wenden. Das sind die sogenannten „unteren Verwaltungsbehörden“ oder die Behörden, denen nach Landesrecht die Aufgabe der Straßenverkehrsbehörde zugewiesen wurde.[20] Bei „Gefahr in Verzug“ ist die Polizei zu verständigen und nötigenfalls auf ihre Verantwortung aufmerksam zu machen. „Die Polizei ist gemäß §44 Absatz 2 Satz 2 befugt, bei Gefahr im Verzug zur Aufrechthaltung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs anstelle der zuständigen Behörde selbst vorläufige Maßnahmen zu treffen“[21]


Die anderen Fragestellungen:
- Zurück: Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es?
- Zurück: Welche Regelwerke kommen zur Anwendung?
- Weiter: Welche Vorgaben und Kriterien gibt es für die Einrichtung von Baustellen?
- Weiter: Was muss getan werden, um die Situation von Fußgängern neben Baustellen zu verbessern?
Hier finden Sie die vollständige Inhalts-Übersicht und die Startseite des Themenbereichs Baustellen-Umgehungen. Bei Interesse können Sie sich den Text auch als Broschüre herunterladen und ausdrucken.
Verwendete Quellen und Anmerkungen:
[1] Wolfgang Schulte: Mehr Sicherheit und Qualität an Arbeitsstellen …, in: Straßenverkehrstechnik 8.2013, S. 527
[2] In der Gesetzessprache und in den Richtlinien werden Baustellen in der regel als „Arbeitsstellen“ bezeichnet.
[3] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Straßenverkehrs-Ordnung StVO, in der Fassung vom 6. März 2013, § 45 (2)
[4] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) in der Fassung vom 17. Juli 2009, zu StVO § 45 (6), Nr. I
[5] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) in der Fassung vom 17. Juli 2009, zu StVO § 45 (2), Satz 1, Nr. I
[6] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Straßenverkehrs-Ordnung StVO, in der Fassung vom 6. März 2013, § 45 (1), Satz 1 und 2, Nr. 1
[7] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) in der Fassung vom 17. Juli 2009, zu § 45 (1) bis (1f), Nr. I
[8] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen und Straßen (ZTV-SA), Köln, Ausgabe 1997, Punkt 2., Absatz 7
[9] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) in der Fassung vom 17. Juli 2009, zu § 45 (6), Nr. III und IV
[10] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Straßenverkehrs-Ordnung StVO, in der Fassung vom 6. März 2013, § 45 (6) und § 46 (1)
[11] z.B. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Städtebau: Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99), 1999
[12] z.B. Praxisratgeber für „Gefahr- und Arbeitsstellensicherung an Straßen“ vom Deichmann + Fuchs Verlag
[13] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Straßenverkehrs-Ordnung StVO, in der Fassung vom 6. März 2013, § 45 (6)
[14] Nach Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Straßenverkehrs-Ordnung StVO, in der Fassung vom 6. März 2013, § 45 in RSA B., 1.5, Absatz 10, vgl. Abschnitte 1.3.1 und 1.3.2
[15] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV: Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen RSA21, Ausgabe 2021. Köln 2021, Teil A., Punkt 1.6.2, Absätze 1 und 2
[16] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) in der Fassung vom 17. Juli 2009, zu § 45(6), Nr. II und IV
[17] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV: Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen RSA21, Ausgabe 2021. Köln 2021, Teil A., Punkt 1.6.2, Absatz 1
[18] Bernhard König: Baustellen im Straßenverkehr, Rüsselsheim, www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/123/binarywriterservlet?imgUid=e504236a-0b10-b11c-5ec3-f12109241c24&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111 (letzter Zugriff 05.09.2013 10:28 Uhr)
[19] Bernhard König: Baustellen im Straßenverkehr, Rüsselsheim, www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/123/binarywriterservlet?imgUid=e504236a-0b10-b11c-5ec3-f12109241c24&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111 (letzter Zugriff 05.09.2013 10:28 Uhr)
[20] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Straßenverkehrs-Ordnung StVO, in der Fassung vom 6. März 2013, § 45 (1), Nr. 1
[21] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV: Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen RSA21, Ausgabe 2021. Köln 2021, Teil A., Punkt 1.6.3, Absatz 5
Die insgesamt zu diesem Thema verwendete Literatur stellen wir Ihnen noch einmal zusammengefasst zur Verfügung.
Bei weitergehenden Anregungen und auch Bedenken gegenüber den Aussagen dieser Informationen nehmen Sie bitte mit FUSS e.V. Kontakt auf.
Dieser Beitrag wurde von Bernd Herzog-Schlagk aus Gransee unter Mitarbeit durch Elisabeth Güth aus Göttingen verfasst. Fotos: Carola Martin, Galerie/Lichtbildkunst „Zitronengrau“ (Rheinsberg), Elisabeth Güth (Göttingen) und Bernd Herzog-Schlagk (Gransee). Die Rechte für alle Fotos liegen grundsätzlich beim FUSS e.V.
Ein Artikel zum gleichen Thema erschien in der mobilogisch!, der Vierteljahres-Zeitschrift für Ökologie, Politik und Bewegung, Heft 4/2013. Einzelhefte der mobilogisch! können Sie in unserem Online-Shop in der Rubrik Zeitschrift bestellen.
Welche Regelwerke kommen zur Anwendung?

Die folgenden Regelwerke stellen eine Ergänzung und Konkretisierung der gesetzlichen Grundlagen dar, können diese aber nicht aufheben:
- Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen und Straßen (ZTV-SA)
- Weitere Richtlinien und Empfehlungen
- Normen
Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)
Die RSA sind von der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV) verfasste Richtlinien. Sie wurden schon bekanntgegeben und können verwendet werden, müssen aber erst verbindlich von den Ländern eingeführt werden.[1] In ihnen werden die Anforderungen der StVO aufgegriffen, sie können aber als untergeordnetes Regelwerk deren Grundsätze (z.B. Sicherheit, fließender Verkehr) nicht verdrängen. Die vorhergehende Version (RSA 95) wurde vom Bundesministerium für Verkehr im Einvernehmen mit den zuständigen obersten Landesbehörden für Bundesfern- und Landesstraßen verbindlich eingeführt.[2] Sie wurde den kommunalen Baulastträgern aber lediglich zur Anwendung empfohlen.
Sie sind das Grundlagenwerk für alle Beteiligten, für die Bauherren, Bauunternehmen und die zuständigen Behörden. Die RSA gliedern sich in vier Teile, wobei im Teil A die Grundbegriffe und Grundsätze erläutert werden und sich im Wesentlichen lediglich der Teil B mit der Absicherung von Arbeitsstellen [3] an innerörtlichen Straßen beschäftigt. Aus ihr gehen die rechtlichen Anordnungen und die Anforderungen für einen Verkehrszeichenplan hervor.
In der Systematik der FVSG sind die RSA ein Regelwerk der 1. Kategorie. Somit haben sie die oberste FGSV Verbindlichkeit. (Mehr zur FGSV-Systematik)
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen und Straßen (ZTV-SA)
Im Gegensatz zu den RSA sind die ZTV-SA [4] nur verbindlich wenn sie Vertragsbestandteil sind. Sie beinhalten konkrete technische Ausführungsvorschriften zu z.B. Schrammborden, Bauzäunen, Behelfsbrücken usw.
Weitere Richtlinien und Empfehlungen
Zu beachten sind darüber hinaus die von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) in Köln erarbeiteten und vom Bundesverkehrsminister sowie den Verkehrsministerien der Länder mehr oder weniger verbindlich eingeführten Richtlinien und Empfehlungen. Sie dienen als Planungs- und Entscheidungshilfen und stellen als sogenannter „Stand der Technik“ zweckmäßige und erprobte Umsetzungsmaßnahmen vor.
Für die Einrichtung von öffentlichen Fußverkehrsanlagen sollten insbesondere folgende Regelwerke beachtet werden:
- Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) [5], die
- Empfehlungen für die Anlage von Fußverkehrsanlagen (EFA) [6] sowie die
- Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen (H BVA) zur Vertiefung der vorangestellten Regelwerke [7]
- Für nichtöffentliche Wege gelten die
- Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR).[8]
Die Erläuterung weiterer straßenbaulicher Regelwerke finden Sie unter Planungsgrundlagen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine Übersicht über alle geltenden fußverkehrsrelevanten Planungsgrundlagen.
Zu den Baustellen-Absicherungen gibt es zudem Unfallverhütungsvorschriften, die sich auf den Schutz der Beschäftigten beziehen [9], Regelwerke über die Ausbildung des Fachpersonals [10], die Notwendigkeit einer Baustellenkoordination [11] sowie über die notwendige Qualität von Verkehrssicherungselementen [12], die aber für die Betrachtung von Baustellen-Umgehungen weniger relevant sind.
Normen
Die Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN) zeigen einen Standard, der materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlichen soll. Sie stehen frei zur Anwendung, das heißt sie können angewandt werden, sind aber nicht vorgeschrieben. Durch private oder gesetzliche Verträge können sie allerdings für verbindlich erklärt werden. Für die Sicherung von Arbeitsstellen sollten insbesondere die Normen zum barrierefreien Bauen Beachtung finden.[13] Empfehlenswert ist die Hinzuziehung eines erläuternden Handbuches.[14]


Die anderen Fragestellungen:
- Zurück: Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es?
- Weiter: Wie ist die Zuständigkeit für die ordnungsgemäße Absicherung einer Baustelle geregelt?
- Weiter: Welche Vorgaben und Kriterien gibt es für die Einrichtung von Baustellen?
- Weiter: Was muss getan werden, um die Situation von Fußgängern neben Baustellen zu verbessern?
Hier finden Sie die vollständige Inhalts-Übersicht und die Startseite des Themenbereichs Baustellen-Umgehungen. Bei Interesse können Sie sich den Text auch als Broschüre herunterladen und ausdrucken.
Verwendete Quellen und Anmerkungen:
[2] Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen BMVBS: Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen RSA, Ausgabe 1995/2009 (4. überarbeitete Auflage 2001 mit zusätzlichen redaktionellen Hinweisen zur StVO und VwV-StVO vom September 2009). Bonn 2009
[3] In der Gesetzessprache und in den Richtlinien werden Baustellen in der Regel als „Arbeitsstellen“ bezeichnet.
[4] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen und Straßen (ZTV-SA), Köln, Ausgabe 1997
[5] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf (Hrsg.): Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt06 (R1), Ausgabe 2006, Köln 2007
[6] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf (Hrsg.): Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen EFA, Köln, Ausgabe 2002
[7] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf (Hrsg.): Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen HBVA (W1), Ausgabe 2011, Köln 2011, 0. Einordnung des Regelwerkes
[8] Ausschuss für Arbeitsstätten – ASTA-Geschäftsführung (Hrsg.): Technische Regeln für Arbeitsstätten - Verkehrswege (ASR A1.8), Ausgabe: November 2012
[9] Unfallverhütungsvorschrift Bauarbeiten (BG-Vorschrift C22)
[10] Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99),
[11] Baustellenverordnung: Einsatz eines Baustellenkoordinators (SiGe-Koordinator) und Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Planes (SiGe-Plan)
[12] Technische Lieferbedingungen (TL): z.B. TL Absperrschranken, TL Leitbaken, TL-Aufstellvorrichtungen, usw.
[13] DIN 18040-3. Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum (Ausgabe 2014-12)
Die insgesamt zu diesem Thema verwendete Literatur stellen wir Ihnen noch einmal zusammengefasst zur Verfügung.
Bei weitergehenden Anregungen und auch Bedenken gegenüber den Aussagen dieser Informationen nehmen Sie bitte mit FUSS e.V. Kontakt auf.
Dieser Beitrag wurde von Bernd Herzog-Schlagk aus Gransee unter Mitarbeit durch Elisabeth Güth aus Göttingen verfasst. Fotos: Carola Martin, Galerie/Lichtbildkunst „Zitronengrau“ (Rheinsberg), Elisabeth Güth (Göttingen) und Bernd Herzog-Schlagk (Gransee). Die Rechte für alle Fotos liegen grundsätzlich beim FUSS e.V.
Ein Artikel zum gleichen Thema erschien in der mobilogisch!, der Vierteljahres-Zeitschrift für Ökologie, Politik und Bewegung, Heft 4/2013. Einzelhefte der mobilogisch! können Sie in unserem Online-Shop in der Rubrik Zeitschrift bestellen.
Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es?

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Wiener Straßenverkehrskonvention
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Rechte von Menschen mit Behinderungen
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Grundsätzlich gilt für die Verkehrssicherungspflicht das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB): „Wer […] fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit […] eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.“ [1]Infolgedessen gibt es auch strafrechtlich keine Freiräume in der Verantwortung für die Verkehrssicherung.
Wiener Straßenverkehrskonvention
Hier handelt es sich um eine internationale Vereinbarung, die bereits 1968 von der UN-Konferenz erarbeitet und in Deutschland 1979 in Kraft getreten ist. Darin verpflichtet sich die Bundesrepublik Deutschland u.a. „zu verbieten, dass auf Gehwegen und begehbaren Seitenstreifen keine Vorrichtungen oder Geräte angebracht werden, die den Fußgängerverkehr, insbesondere ältere und behinderte Personen, unnötig beeinträchtigen.“[2] Diese Aussage gilt grundsätzlich und ist nicht mit dem Hinweis auf „beengte Verhältnisse“, wie sie Baustellen häufig darstellen, aufzuheben.
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Als vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) eingeführte Rechtsverordnungen enthalten die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) [3] neben der allgemeinen Verkehrsregelung auch Vorgaben, die auf die Baustellensicherung anzuwenden sind. Danach dürfen „Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs nur“ unter ganz bestimmten Kriterien vorgenommen werden.[4] Hier wird von „Verkehr“ ganz allgemein gesprochen. Die Leichtigkeit des motorisierten Kraftfahrzeug-Verkehrs auf der einen Seite kann daher kein Argument für die Sperrung des Fuß- oder Radverkehrs auf der anderen Seite darstellen. Dies gilt insbesondere, wenn keine zumutbaren Alternativen angeboten werden. In der VwV-StVO wird dazu ausgeführt: "Die Flüssigkeit des Verkehrs ist mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu erhalten." Durch die StVO-Novellierung wurde im Jahr 2009 hinzugefügt: "Dabei geht die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer der Flüssigkeit des Verkehrs vor."[5]
In der Gesetzessprache werden „Baustellen“ als „Arbeitsstellen“ [6] bezeichnet, unabhängig davon, ob zeitnah in ihnen gearbeitet wird. In der StVO und der VwV-StVO werden die Zuständigkeit [7] und die entsprechenden Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen [8] geregelt und ansonsten darauf verwiesen, dass „die Sicherung von Arbeitsstellen und der Einsatz von Absperrgeräten [...] nach den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)“ erfolgt.[9]
Rechte von Menschen mit Behinderungen
Im Jahr 1994 wurde das Grundgesetz durch folgenden Absatz ergänzt: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“[10] Damit ist „die Grundlage zur Integration bzw. Inklusion von Menschen mit Behinderungen in das öffentliche Leben geschaffen worden.“[11] Im Frühjahr 2002 trat zur Konkretisierung dieser Forderung das Behindertengleichstellungsgesetz BGG in Kraft, in dem auch die Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr geregelt ist.[12] 2008 ratifizierte die Bundesrepublik Deutschland das Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN) über die Rechte von Menschen mit Behinderungen mit gleicher Zielsetzung.[13] 2010 wurde die „Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen“ veröffentlicht, nach der der gleichberechtigte Zugang zu allen Einrichtungen auch im Verkehr zu gewährleisten ist.[14]


Die folgenden Fragestellungen:
- Welche Regelwerke kommen zur Anwendung?
- Wie ist die Zuständigkeit für die ordnungsgemäße Absicherung einer Baustelle geregelt?
- Welche Vorgaben und Kriterien gibt es für die Einrichtung von Baustellen?
- Was muss getan werden, um die Situation von Fußgängern neben Baustellen zu verbessern?
Hier finden Sie die vollständige Inhalts-Übersicht und die Startseite des Themenbereichs Baustellen-Umgehungen. Bei Interesse können Sie sich den Text auch als Broschüre herunterladen und ausdrucken.
Verwendete Quellen und Anmerkungen:
[1] Bürgerliches Gesetzbuch BGB, § 823
Wiener Straßenverkehrskonvention oder Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr, Beschluss 8. November 1968, Änderungsstand 3.September 1993, Art. 4 Verkehrszeichen, Absatz d) iii
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) in der Fassung vom 17. Juli 2009
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Straßenverkehrs-Ordnung StVO, in der Fassung vom 6. März 2013, §45, (9), 2. Satz
An der Aufnahme dieser Aussage war der FUSS e.V. maßgeblich beteiligt. Dieser Absatz steht keineswegs an einer zentralen Stelle, sondern in der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) zu §§ 39 bis 43 Allgemeines über Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen Ziffer I., Nummer 2. (Randnummer 4).
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) in der Fassung vom 17. Juli 2009, zu § 43, Absatz 3 Nr. 2
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Straßenverkehrs-Ordnung StVO, in der Fassung vom 6. März 2013, § 44
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Straßenverkehrs-Ordnung StVO, in der Fassung vom 6. März 2013, §45 und § 39 bis § 43
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) in der Fassung vom 17. Juli 2009, zu § 43 Verkehrseinrichtungen, Absatz 3 Nr. 2, I. (Randnummer 2)
Diskriminierungsverbot als Zusatz im Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes GG
Zitiert nach Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf (Hrsg.): Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen HBVA (W1), Ausgabe 2011, Köln 2011, 1. Grundsatz
Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen – Behindertengleichstellungsgesetz BGG vom 27.04.2002 (BGBl. I S. 1467-1468)1, (BGBl. III 860-9-2), zuletzt geändert durch das Verwaltungsvereinfachungsgesetz vom 21.03.2005 (BGBl. I S. 818, 830), § 8
UN-Behindertenrechtskonvention, Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13.12.2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13.12.2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BGBl. I Nr. 35, Seite 1419-1457 vom 21.12.2008).
Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020: Erneuertes Engagement für ein barrierefreies Europa, KOM(2010)636, Abschnitt: Zugänglichkeit, Brüssel 15.11.2010
Die insgesamt zu diesem Thema verwendete Literatur stellen wir Ihnen noch einmal zusammengefasst zur Verfügung.
Bei weitergehenden Anregungen und auch Bedenken gegenüber den Aussagen dieser Informationen nehmen Sie bitte mit FUSS e.V. Kontakt auf.
Dieser Beitrag wurde von Bernd Herzog-Schlagk aus Gransee unter Mitarbeit durch Elisabeth Güth aus Göttingen verfasst. Fotos: Carola Martin, Galerie/Lichtbildkunst „Zitronengrau“ (Rheinsberg), Elisabeth Güth (Göttingen) und Bernd Herzog-Schlagk (Gransee). Die Rechte für alle Fotos liegen grundsätzlich beim FUSS e.V.
Ein Artikel zum gleichen Thema erschien in der mobilogisch!, der Vierteljahres-Zeitschrift für Ökologie, Politik und Bewegung, Heft 4/2013. Einzelhefte der mobilogisch! können Sie in unserem Online-Shop in der Rubrik Zeitschrift bestellen.